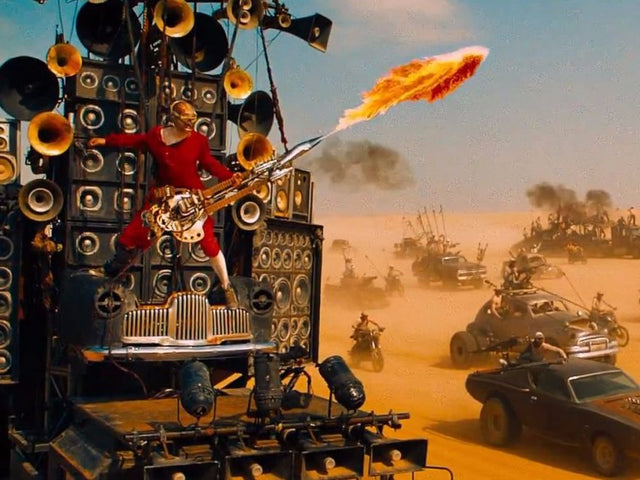Nur der Tod ist echt: Die lebensbejahende Kraft des 1. Songs von Bell Witch, 83-minütigen Mirror Reaper
Normalerweise hebt Deaf Forever jeden Monat die besten Metal- (und metallischen) Platten hervor. In der Oktoberausgabe werden wir uns eingehend mit einer Platte befassen, die so massiv ist, dass sie eine eigene Spalte benötigt: Bell Witchs Mirror Reaper, die letzten Monat bei Profound Lore veröffentlicht wurde.
„Nur der Tod ist real.“
Hellhammer, die Schweizer Band, die letztendlich zu den Metal-Pionieren Celtic Frost werden sollte, machte diesen Satz in ihrem Song „Messiah“ aus ihrem Satanic Rites Demo berühmt. Es ist eine einfache Wahrheit, dass unser einziges wirklich gemeinsames Band darin besteht, dass wir letztendlich alle sterben werden. Es war eine Wahrheit, die zu ihrem brutalen Sound passte, dem Ursprung von Death und Black Metal, roh und necro in voller Blüte. Dieser Satz erhielt eine neue Bedeutung, als ihr Bassist Martin Ain am 21. Oktober starb. Metal verlor einen seiner wichtigsten Architekten, und das war einer unserer bedeutendsten Verluste seit geraumer Zeit.
„Nur der Tod ist real.“
Ja, kein Scheiß. Ich weiß das nur zu gut.
Ich denke ziemlich oft darüber nach, auf die andere Seite zu gehen. Über die Bereiche des Todes hinaus. Diese Gedanken haben sich in den letzten Jahren intensiviert, trotz regelmäßiger Beiträge, trotz Therapie, trotz eines Unterstützungssystems, das die meisten Menschen ohne Suizidgedanken extrem verdammt lucky machen würde. Die Band, die mir am meisten geholfen hat, diese Gedanken in Schach zu halten, ist Bell Witch, ein in Seattle ansässiges Doom-Duo, bestehend aus dem Bassisten/Sänger Dylan Desmond und dem Schlagzeuger/Sänger Jesse Shreibman. Wenn ich ihnen zuhöre, zehren sie an der unheimlichsten Manifestation meiner Depression und zerfressen sie durch Desmonds doppelte Rolle als Hammerer und melodischen Treiber, indem sie Wellen von erdrückendem Bass und gleichzeitig die zartesten Melodien heraufbeschwören.
Das dritte Album von Bell Witch, Mirror Reaper, ist ein einziger 83-minütiger Titel, ihr einschüchterndstes und gleichzeitig ihr bekräftigendstes Werk bis jetzt. Seine Länge ist gerechtfertigt, denn es ist alles über Bell Witch auf das Äußerste getrieben. Desmonds Melodien waren noch nie so schön, und sein Doom war noch nie so schwer. Gewicht wurde noch nie so bösartig und so freizügig herumgeworfen. Mirror trifft wie Felsbrocken, aber Felsbrocken, die von Wesen geworfen werden, die mindestens einen ganzen Planeten stemmen können. Doomige Plods fühlen sich noch länger gezogen, noch gequält an, fast so, als könnte man ein Gesicht fühlen, das sich in die Verdammnis verkrümmt. Shreibman bringt auch die Orgel ins Spiel und fügt eine weitere Schicht atemberaubender Verzweiflung hinzu.
„Nur der Tod ist real“, denn Gott ist es nicht. Mirror wirkt als Messe für die Despiritierten, für die Glaubenslosen, für die wirklich Verlorenen. Deshalb sollte es als ein einziger Track gehört werden. Selbst wenn du nicht an das Leben nach dem Tod glaubst, ist Mirror spirituell, eine Reise in eine alternative Realität, in der Trennung die ultimative Erlösung ist, zum Preis des Lebens. Desmond spielt mit Anbetung, mit einem geisterhaften Gespenst niemals weit dahinter; Shreibman ist ebenfalls devot, schweißt die Kraft eines Raptus ohne dessen Freude. Wie auf jeder Bell Witch-Platte trägt der Aerial Ruin-Sänger Erik Moggridge klangvolle Cleans bei, und er sollte inzwischen als drittes Mitglied der Band betrachtet werden. Er fungiert als Charon von Bell Witch und leitet dich durch einen Styx jeder verlockenden Möglichkeit von Selbstverletzung und Tod, während er dich auf die Wärme des Lebens steuert, die letztlich es wert ist, wenn auch fern. Moggridge kommt mehr als 51 Minuten in Mirror dazu, und selbst nach fast einem ganzen Album, das in den meisten Bands angesichts vergangen ist, wird die echte Verwüstung noch kommen. Er ist am mächtigsten, wenn Desmonds Bass am einsamsten ist. Wenn Shreibmans Orgel einsetzt, wächst Moggridges Stimme nur noch himmlischer. Seine Stimme wird Licht, wird ein navigationaler Stern. Wenn seine Stimme verklingt, wird der Himmel in einem Augenblick schwarz, und Orgel und Bass sind mehr zuckende Funken als wütende Feuer. Wie Desmonds Spiel trägt sie sowohl unermessliches Gewicht mit Leichtigkeit als auch das Gefühl, dass sie jederzeit auseinanderfallen könnte.
Der Tod schwebt über Bell Witch auf Mirror mehr denn je - der ehemalige Schlagzeuger/Sänger Adrian Guerra starb letztes Jahr, und einige seiner Vocals, die während ihrer letzten Platte Four Phantoms aufgenommen wurden, erscheinen hier, möglicherweise die letzte Aufnahme, auf der er je sein wird. Sie kommen in der Mitte des Albums, in einer Orgie aus schmerzhaften Growls und Kreischen. Eine Feier? Eine Beerdigung? Ein Angriff? Es ist alles davon, und sein Erscheinen aus dem Griff des Todes macht Sinn, dennoch ist es immer noch ein Mindfuck. Wir wurden in diese Trauer hineingezogen, wir unterwerfen uns ihr, weil wir Bell Witch nicht hören, wenn wir uns gut fühlen. Wir schwelgen in der Trauer, und es löscht nicht aus, wie beunruhigend es ist, ihn zu hören.
Nur zwei andere Platten in diesem Jahr stehen neben Mirror: Loss’ Horizonless (das Guerra gewidmet ist) und Mount Eerie’s A Crow Looked At Me, die beide Trauer in ihrer aufregendsten Form erforschen. Loss geht die Dunkelheit an, die romantisierend ist; Mount Eerie’s Album ist ein Schritt-für-Schritt-Bericht über den Verlust deiner Frau und das Alleinleben deiner Tochter, über das grausame Entfernen deines Traumlebens ohne Gnade, ohne viel sinnvolle Erklärung, Schicksal, das dich verarscht. Mirror’s Platz ist das, was für Bell Witch immer funktioniert hat: Sie verstehen, mehr als jede andere Band, den physischen Schmerz, sich so sehr zu hassen, dass man sterben möchte. Wir wissen, dass Suizid Gewalt ist, aber nur in der finalen Handlung. Bis zu diesem Punkt ist das Leben auch Gewalt, gegen diese Gedanken zu kämpfen, drained dich dabei. Und es manifestiert sich physisch, denn das Mentale ist oft auch das Physische. Deshalb schneiden Desmonds Zeilen, so schön sie auch sind, so lebhaft mit Qual. Deshalb fühlen sich Shreibmans Schläge wie die Hände des Schicksals an, die auf dich herabkommen. Deshalb ist die Schönheit von Mirror so turbulent, wie Doom am langsamsten und schwersten sein kann und dennoch am aerodynamischsten. Trauer ist alles verzehrend, deshalb würde Mirror keinen Sinn machen, wenn es zerbrochen wird.
Neulich sah ich das erste Konzert des britischen Quartetts Warning in Austin auf einer Tour, bei der sie ihr zweites Album Watching From A Distance in seiner Gesamtheit spielten. Sie waren ihrer Zeit voraus - Pallbearer entlehnte viel von ihrem Sound - aber Patrick Walker brachte eine neue Verwundbarkeit ein, mit der viele in der Metal-Welt aufholen müssen. „Footprints“ ist wunderschön, weil es so verheerend ist, Walker klingt wie ein Sieger, der schwer verletzt ist, hoch aufsteigend, während er sich in einen endlosen Abstieg wirft. Die letzte Strophe verfolgt mich am meisten: „Und durch all die Kämpfe um mich herum/glaubte ich nie, dass ich kämpfen würde,/Doch hier stehe ich als gebrochener Soldat/ Zittern, nackt, in deinem Winterlicht“, Walker öffnete sich und gab die Niederlage zu, verwelkte in der Kälte, und dennoch ist er auch siegreich, weil er den Willen dazu hat. Sie ebneten den Weg für Bell Witch und viele andere langsame Doom-Acts, und das Sehen von Warning bekräftigte, wie mächtig Mirror wirklich ist. Es ist eine Metal-Platte, die nicht fragt, was du überwinden kannst oder wie du deinen Geist zur Transzendenz strecken kannst; sie fragt dich, tapfer gegen die Kälte des Lebens zu sein, wo du gewinnen kannst, indem du es alles von dir nehmen lässt.
„Nur der Tod ist real.“ Mirror bekräftigt und fordert auch diese Realität heraus, die dich zu den Extremen des Schmerzes führt, dass der Tod sehr wohl ein Teil des Lebens ist, aber es gibt mehr dazu. Und letztendlich ist es das, was der beste Metal tut: Er bringt Ströme von Negativität und Gewalt hervor, schmerzt dich über das Verständnis hinaus, im Dienst, dass das Leben lebenswert ist. Es gibt keinen falschen Weg zu trauern, was zählt, ist, dass du dir den Raum dafür gibst. Lass es dich verschlingen, so wie ich es Bell Witch in meinen schlimmsten Stunden habe tun lassen.
Andy O’Connor heads SPIN’s monthly metal column, Blast Rites, and also has bylines in Pitchfork, Vice, Decibel, Texas Monthly and Bandcamp Daily, among others. He lives in Austin, Texas.
Trete dem Club bei!
Jetzt beitreten, ab 44 $Exclusive 15% Off for Teachers, Students, Military members, Healthcare professionals & First Responders - Get Verified!